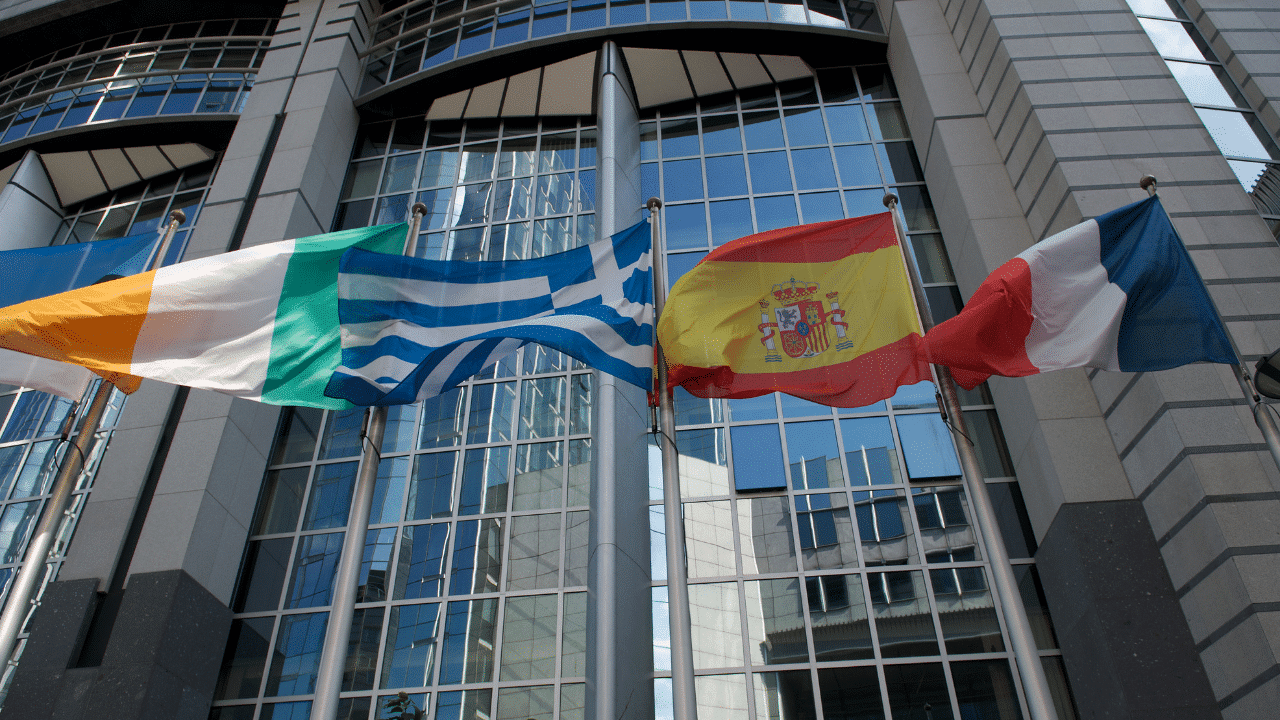Handlungsempfehlungen
- Die EU braucht eine dialogorientierte Krisenkommunikation.
- Die EU braucht mehr Kompetenzen im Sozial- und Gesundheitsbereich zur besseren Prävention.
- Die EU braucht eine Reformdebatte im großen Stil.
Zusammenfassung
Die Europäische Union scheint aus dem Krisenmodus nicht mehr herauszukommen. Seit mehr als einem Jahrzehnt reiht sich eine unerwartete Herausforderung an die andere. In einer dauerhaften latenten Krise, die durch ungelöste Struktur- und Prozessfragen (etwa in der Asyl- und Migrationspolitik und als Folge der Euro-Krise etc.) gekennzeichnet ist, stellt die akute Krise rund um COVID-19 die Grundprinzipien der Union weiter in Frage. In den letzten Wochen zogen sich manche Mitgliedstaaten ohne Abstimmung auf ihre eigene Politik zurück, schlossen Grenzen und verhängten Ausfuhrverbote. Die EU wurde gleichzeitig immer wieder als untätig kritisiert. Doch dieser Vorwurf muss bei genauer Betrachtung stark relativiert werden. Denn auch wenn die Mitgliedstaaten mehr Spielraum für Notfallmaßnahmen haben, so hat die EU doch von der Öffentlichkeit weitgehend unbemerkt maßgeblich zum Krisenmanagement beigetragen. Ihr Problem liegt weniger in der akuten Krisenreaktion als in Versäumnissen der Vergangenheit und darin, dass sie in der Propagandaschlacht verschiedener anti-europäischer Akteure nicht durchkommt und noch dazu von manchen Regierungen der Mitgliedstaaten öffentlich des Versagens beschuldigt wird. Darüber hinaus hat sie kaum Kompetenzen im Gesundheits- und Sozialbereich, hat wie in anderen Bereichen zu sehr auf ökonomische Effizienz gedrängt und bräuchte dringend eine transparente sowie breit geführte Reformdebatte.
****************************
Europa in und nach der Corona-Krise
Einleitung
Als der römische Feldherr Publius Quinctilius Varus im Jahre 9 n. Chr. in der nach ihm benannten Schlacht gegen die Germanen eine verheerende Niederlage einfuhr, soll Kaiser Augustus ausgerufen haben: Varus, Varus, gib mir meine Legionen wieder! In Anbetracht der Corona-Krise ist man als ironie-affiner Pro-Europäer geneigt, den Spruch leicht abzuwandeln in „Virus, Virus, gib mir mein Europa wieder!“. Denn nach ohnehin schweren Jahren für die EU scheint die Pandemie den letzten Rest des europäischen Zusammenhalts, der Basis des gesamten Integrationsprozesses, zerstört zu haben. Zumindest vermitteln viele PolitikerInnen und Medien seit Ende Februar, Anfang März 2020 das Bild, die EU würde versagen (vgl. Bild 29.03.2020), es gäbe nur Nationalstaaten auf diesem Kontinent, aber keine funktionierende supranationale Union, geschweige denn eine supranationale Solidarität (Die Welt 16.03.2020). Dieser Eindruck entsteht in erster Linie durch eine nationalstaatlich dominierte Kommunikationsstrategie und eine bereits länger andauernde Propagandaschlacht, in der die Europäische Union nicht mithalten kann (vgl. Der Standard 8.04.2020).
Die Corona-Krise zeigt tatsächlich, dass die EU weit davon entfernt ist, im Notfall wie eine Regierung handeln und kommunizieren zu können. Erstens, weil sie die Kompetenzen dazu nicht hat, zweitens, weil es an Loyalität und Solidarität mangelt und drittens, weil ihr Krisenmanagement von manchen Mitgliedstaaten unterminiert wird, etwa wenn Grenzen ohne Absprache geschlossen oder Ausfuhren in den Binnenmarkt gestoppt werden. Daraus resultieren Gefahren für den Zusammenhalt der EU. Wenn die EuropäerInnen den Eindruck gewinnen, die Union bringe ihnen nichts, sondern ließe sie sogar im Stich, und wenn einzelne Staaten diese Krise nutzen, um in autoritäre Verhältnisse abzudriften, dann werden anti-europäische Kräfte gestärkt und eine Renationalisierung vorangetrieben. Gleichzeitig gibt es aber auch die Theorie, dass die EU seit ihren Anfängen aus Krisen gestärkt hervorgehe und danach nötige Reformen leichter durchsetzbar wären. Ob das allerdings auch diesmal eintritt, hängt von vielen Faktoren ab. Aus der Corona-Krise können jedenfalls jetzt schon Schlüsse für die EU gezogen werden.
Die akute Krise während der latenten Krise
Seit 2008 kann man von einer raschen Abfolge und einem Aufeinandertreffen von mehreren Krisen sprechen, also einer Entwicklung, die man so bisher nicht kannte.
Es gibt die gut gestützte These, dass der europäische Integrationsprozess durch die Dialektik von Krise und Reform vorangekommen sei (vgl. Weidenfeld 2017). Das Argument lautet in etwa so: Erst durch Krisen sei in der Vergangenheit der Reformdruck groß genug geworden, um die entscheidenden Akteure, insbesondere die Regierungen der Mitgliedstaaten, zum Handeln zu bringen. An Beispielen mangelt es nicht. Die Eurosklerose der 1970er und frühen 1980er Jahre war der Grund für die Reformen, die der Kommissionspräsident Jacques Delors mit Unterstützung des französischen Präsidenten Francois Mitterrand und dem deutschen Kanzler Helmut Kohl eingeleitet hat und die in den EU-Vertrag von Maastricht mündeten. Damals hatte die EG/EU 12 Mitgliedstaaten. Die verschiedenen Probleme und Herausforderungen am Ende der 1990er und Anfang der 2000er Jahre führten zum europäischen Konvent, an dem neben VertreterInnen von EU-Kommission und Europäischem Parlament auch Regierungsmitglieder und Abgeordnete der damals 15 Mitgliedstaaten sowie der 10 Erweiterungsländer teilnahmen (vgl. Norman 2004). Der daraus hervorgegangene Verfassungsvertrag scheiterte zwar in Frankreich und den Niederlanden in Referenden, wurde aber 2009 in etwas abgeschwächter Form im Lissabonner Vertrag akzeptiert und von dann bereits 27 Staaten ratifiziert. Doch dieser Vertrag von Lissabon machte die Union keineswegs krisenfest. Seit 2008 kann man sogar von einer raschen Abfolge und einem Aufeinandertreffen von mehreren Krisen sprechen, also einer Entwicklung, die man so bisher nicht kannte. Ab 2010 traf Europa die so genannte Euro-Krise, die in sich als Banken-, Schulden- oder Wirtschaftskrise auftrat und Folge einer globalen Finanzkrise war. 2014 folgte die Ukraine-Krise, die einen Krieg an den Grenzen der EU mit sich brachte und viele Menschenleben kostete sowie das Verhältnis zu Russland weiter und nachhaltig verschlechterte. Die Jahre 2015 und 2016 waren geprägt von der so genannten „Flüchtlingskrise“, die man besser als Krise der europäischen Wertegemeinschaft bezeichnen kann. Durch den restriktiven Kurs vieler Mitgliedstaaten wurden Grundprinzipien des europäischen Einigungswerks in Frage gestellt und nationale Alleingänge vollzogen. Hinzu kamen Terrorattacken von politischen und religiösen Fanatikern in verschiedenen EU-Staaten sowie das Austrittsreferendum der Briten, das im Anschluss zum BREXIT führte. Die Wahl Donald Trumps zum neuen US-Präsidenten und die damit verbundene Infragestellung der engen Beziehungen zu den USA kann als weitere kritische Novität nach 1945 betrachtet werden. Außerdem wird erstmals gegen zwei Mitgliedstaaten der Artikel 7 bemüht, und zwar gegen Polen und Ungarn. Keine dieser zuletzt genannten Entwicklungen wurde bisher von der Union durch größere Reformbemühungen bewältigt. Insofern scheint die Dialektik von Krise und Reform in den letzten Jahren nicht mehr zu wirken oder zumindest noch nicht absehbar. Und in genau dieser Situation trifft die Welt eine globale Pandemie und bringt damit auch das ohnehin angeschlagene Europa ins Wanken.
Was als Krise zu bezeichnen ist und was nicht, ist indes gar nicht so einfach zu beantworten. Im Rahmen der Europäischen Einigung kann man von mindestens zwei Formen der Krise ausgehen, einer latenten und einer akuten (vgl. Merkel 2016). Die latente zeichnet sich dadurch aus, dass sie sich über einen längeren Zeitraum hin entwickelt und einen gewissen Handlungsspielraum lässt, während die akute plötzlich auftritt und rasches Handeln erfordert. Die Eurosklerose der 1970er und 1980er Jahre etwa kann als latente Krise betrachtet werden, die sich über viele Jahre hinzog und Zeit bot, darauf durch Vertragsreformen zu reagieren. Die Corona-Krise hingegen ist ohne jeden Zweifel eine akute, in der umgehend gehandelt werden muss.
Was die Lage 2020 daher so besonders schwierig macht: Die akute Krise kommt in einer latenten Krise, die bereits seit einigen Jahren andauert.
Für die Europäische Union ist es in beiden Krisenformen schwierig, das Heft des Handelns in die Hand zu bekommen. Sowohl latente Krisen als auch akute kann sie nur dann erfolgreich angehen, wenn die Mitgliedstaaten mitziehen. Denn die Union selbst ist weit davon entfernt, wie ein Staat agieren zu können. Sie ist ein Mix sui generis zwischen einer supranationalen Föderation und einer internationalen Organisation (vgl. Hrbek 2003). Wie man an vielen Beispielen der letzten Jahre gesehen hat, sind ihre Handlungsoptionen limitiert. Wenn einzelne Mitgliedstaaten dann noch auf stur schalten und sich gegen europäische Entscheidungen querlegen, wie das etwa bei der Verteilung von Geflüchteten der Fall war, dann wirkt die Union schnell wie eine lahme Ente. In der öffentlichen Debatte heißt es dann stets: Die EU versagt oder die EU-Kommission tut nichts usw. In latenten Krisen kann dieser Eindruck auch entstehen, aber in akuten Krisen ist er umso dramatischer. Die krisenhaften Entwicklungen der letzten Jahre, die oben genannt wurden, waren zum Teil durchaus akut, aber sie hatten sich seit einigen Monaten doch eher in eine latente Krise gewandelt. Was die Lage 2020 daher so besonders schwierig macht: Die akute Krise kommt in einer latenten Krise, die bereits seit einigen Jahren andauert.
Das Hauptproblem der EU liegt eher in einer Propagandaschlacht, die schon länger andauert sowie in der Unfähigkeit oder dem Unwillen der Mitgliedstaaten, der Union ihre Erfolge zu gönnen.
In Anbetracht dessen verringern sich zumindest derzeit die Aussichten auf eine ever closer union, eine supranationale Föderation. Hätten wir es nur mit latenten Krisen zu tun, dann wäre die Gefahr eines raschen und radikalen nationalen Rückzugs geringer. Die EU ist ja trotz aller Schwierigkeiten geübt in langen Aushandlungsprozessen und dem Finden von Kompromissen. Im akuten Krisenfall sieht es schlechter aus: Da ziehen sich die Mitgliedstaaten zurück, sind oft sogar bereit, europäische Regelungen eigenmächtig und ohne Abstimmung auszusetzen (vgl. Die Zeit 16.03.2020). Ihre Möglichkeiten, schnell und wirksam einzugreifen, sind deutlich stärker als jene der Union. Sie können polizeilich und militärisch vorgehen, während die EU über keine eigenen Truppen verfügt. Sie können rasch Notfallgesetze beschließen oder -verordnungen in Kraft setzen, während die EU dazu lange Abstimmungen zwischen Institutionen und Mitgliedstaaten benötigt. Sie können Ausgangsbeschränkungen verhängen und alle Abweichungen von Bestimmungen effizient und rasch sanktionieren. Kurz: Ein Mitgliedstaat hat in seinem Handlungsbereich eine breite Palette an Maßnahmen, die er im Notfall relativ rasch umsetzen kann – und er hat die Mittel und Möglichkeiten, für die Einhaltung dieser Maßnahmen zu sorgen. Das alles gilt nicht in gleichem Maße für die EU. Und trotzdem hat sie in der Corona-Krise nicht versagt. Ihr Hauptproblem liegt eher in einer Propagandaschlacht, die schon länger andauert sowie in der Unfähigkeit oder dem Unwillen der Mitgliedstaaten, der Union ihre Erfolge zu gönnen.
Der Krisenmechanismus des Europäischen Rates und die Rolle der Europäischen Kommission
Über Jahrzehnte hinweg gab es auf EU-Ebene gar keinen echten Krisenmechanismus mit einem klaren Ablauf. Für latente Krisen ist das verständlich, weil sich diese immer über längere Zeiträume hinweg ziehen und keinen Notfall darstellen, auch wenn sie ebenso gefährlich sein können. Bei akuten Krisen war die Reaktion Europas die längste Zeit fast ausschließlich von den Mitgliedstaaten abhängig. Diese traten in besonderen Situationen zusammen und stimmten ihr Vorgehen mehr oder weniger aufeinander ab. In einigen Fällen veränderten solche Krisen tatsächlich auch die Strukturen und Abläufe der Europäischen Gemeinschaft. So ist etwa die Institutionalisierung des Europäischen Rates 1974 auf die Zeit nach dem Ölschock von 1973 zurückzuführen. Bis dahin gab es kein Gremium für die Staats- und Regierungschefs im Rahmen der Europäischen Einigung. Da man den supranationalen Gemeinschafts-Institutionen in den Jahrzehnten davor nicht genügend Kompetenzen für Krisenphasen überlassen wollte, führte man mit dem Europäischen Rat ein vorerst informelles intergouvernementales Organ ein (Bulmer/Wessels 1987). Dies geschah auf Initiative des französischen Präsidenten Valéry Giscard d’Estaing. Und dafür war es nötig, die kleineren Mitgliedstaaten zu überreden, dass ein solches Leadership-Gremium nicht ausschließlich von den großen Staaten dominiert würde. Die Aufgabe des Europäischen Rats sollte die Bestimmung der allgemeinen politischen Zielvorstellungen und Prioritäten der Europäischen Union sein. Seit 1992 genießt er offiziellen Status, seit 2009 ist er ein offizielles EU-Organ. Neben den regulären Treffen treten die Staats- und Regierungschefs in außergewöhnlichen Situationen zusammen, etwa in der Euro-Krise, nach Terrorattacken, im Zuge des BREXIT, in der Migrationskrise oder eben jetzt in der Corona-Krise. Dies zeigt, dass aus den Krisen der 1970er Jahre ein ständiges Organ mit gewissen Krisenkompetenzen geworden ist. Bis heute ist dieses intergouvernementale Gremium der zentrale Akteur in akuten Angelegenheiten.
Als Folge der Terrorattacken in New York 2001, in Madrid 2004 und in London 2005 sowie des Tsunamis im Indischen Ozean 2004 verabschiedete der Europäische Rat 2006 die so genannten Krisenkoordinierungsvorkehrungen, die den Informationsaustausch und die Koordination zwischen den Mitgliedstaaten in Krisenfällen beschleunigen und verbessern sollten. 2013 wurde daraus die Integrierte Regelung für die politische Reaktion auf Krisen (IPCR). Diese sollte für mehr Flexibilität sorgen und relevante Strukturen stärken (Website Europäischer Rat). Für das Management von Notfällen wurde außerdem bereits im Oktober 2001 als Folge von 09/11 ein EU-Zivilschutz-Mechanismus entwickelt und 2013 ein Zentrum für die Koordination von Notfallmaßnahmen eingeführt, das Hilfsanfragen von Staaten aufgreift und sie an die Mitgliedstaaten weiterleitet. Diese Einrichtung ist bei der EU-Kommission angesiedelt (Website Europäische Kommission a). Dass es sinnvoll war, einen solchen Mechanismus im Europäischen Rat und ein operatives Zentrum in der Kommission zu etablieren, zeigte sich in den folgenden Jahren immer wieder. Doch erst 2018 erließ der Europäische Rat einen Durchführungsbeschluss, um die IPCR in einem Rechtsakt zu kodifizieren.
Ausgelöst kann der Krisenmechanismus entweder durch die Ratspräsidentschaft oder durch einen Mitgliedstaat werden, der die so genannte Solidaritätsklausel auslöst. Tritt dieser Fall ein, wird die Kommission mit ihren entsprechenden Einrichtungen aktiv. Das Zentrum für die Koordination von Notfallmaßnahmen als Teil der Generaldirektion Europäischer Katastrophenschutz und Humanitäre Hilfe ist dabei der funktionale Ort der Katastrophenschutzverfahren. Dort wird die Bereitstellung von Hilfsgütern und die Soforthilfe koordiniert. Das Zentrum ist rund um die Uhr im Einsatz und hilft nicht nur in EU-Staaten, sondern auch in Katastrophenfällen in anderen Teilen der Welt (Website Europäische Kommission a).
In akuten Krisenfällen ist der Ablauf also in etwa wie folgt: Ein Mitgliedstaat aktiviert die Solidaritätsklausel oder die Ratspräsidentschaft löst den Krisenmechanismus aus. Die EU-Kommission mit ihren zuständigen Einrichtungen übernimmt die Koordination. Wenn ein Katastrophenfall mit humanitärer Relevanz vorliegt, wird das Zentrum für die Koordination von Notfallmaßnahmen aktiv. Auf anderer Ebene, etwa der wirtschaftlichen, kann die EU-Kommission mit anderen Generaldirektionen aktiv werden und Maßnahmen setzen. All dies stets in enger Abstimmung mit den Mitgliedstaaten bzw. dem Europäischen Rat. Im Falle der Corona-Krise ist alles genau nach diesem Schema abgelaufen.
Die Corona-Krise und die Reaktion der EU
Im Dezember 2019 trat COVID-19 erstmals in China auf. Es breitete sich zwar rasch aus, aber anfangs war nicht klar, dass es zu einer Pandemie werden würde. Ende Jänner erreichte es Europa. In Frankreich wurden erste Fälle gemeldet. Die Weltgesundheitsorganisation WHO erklärte bald eine gesundheitliche Notlage von internationaler Tragweite (vgl. Website WHO). Auch die Europäische Union reagierte. Bereits am 28. Jänner aktivierte der kroatische EU-Vorsitz die europäische Krisenreaktionsregelung (Website Europäischer Rat). Im Februar ging die Ausbreitung massiv weiter, vor allem in Italien. Protokolle zeigten später, dass die EU-Kommission bereits Ende Jänner Hilfe bei der gemeinsamen Beschaffung von Schutzmasken, Tests und Beatmungsgeräten angeboten haben soll (Die Presse 02.04.2020). Die Regierungen der Mitgliedsländer reagierten laut Berichten zurückhaltend und lehnten das Angebot ab. Am 13. Februar kam der Rat für Beschäftigung, Sozialpolitik, Gesundheit und Verbraucherschutz zusammen, um zu beraten. Einstweilen versuchten die Mitgliedstaaten bereits individuelle Lösungen auf die jeweils unterschiedlichen Szenarien zu finden. In der Kommission wurde ein Krisenstab eingerichtet. Als vorrangige Aufgabe galt die Unterstützung der Mitgliedstaaten bei der Bewältigung der Situation und die Sicherung eines gemeinsamen Vorgehens. Neben dem politischen Krisenstab aktivierte die Kommission ihr Krisenkoordinierungssystem ARGUS, das alle relevanten Stellen der Union im Krisenfall verknüpft und ein koordiniertes Vorgehen sicherstellt (Website Europäische Kommission b).
Mit Ende Februar und Anfang März wurden in mehreren Staaten die Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus drastisch verschärft. Es kam zu ersten Problemen bei der Einhaltung europäischer Regeln. Medien berichteten über zurückgehaltene Schutzmasken in Deutschland und beklagten die mangelnde Solidarität mit Italien. Die Kritik richtete sich in vielen Berichten und in sozialen Medien jedoch weniger gegen einzelne Mitgliedstaaten, sondern gegen „die EU“ (vgl. Die Welt 16.03.2020). Ab 11. März schlossen Österreich und Slowenien für viele BürgerInnen ihre Grenzübergänge zu Italien, ohne dies mit den EU-Institutionen abgesprochen zu haben. Der französische Präsident Emmanuel Macron kritisierte diese Maßnahme als falsch und forderte mehr Koordination zwischen den Staaten (Kurier 16.03.2020). Bekanntermaßen gingen diese vorerst auf sehr unterschiedliche Weise und in unterschiedlichem Tempo vor. Es folgten Schließungen von Universitäten und Schulen, die Absage von Veranstaltungen, Ausgangsbeschränkungen und andere Maßnahmen.
Die EU schien in der medialen Debatte entweder in den Hintergrund zu treten oder als unsolidarisch und dysfunktional zu gelten. Medien berichteten ausführlich von Hilfsangeboten Chinas, Kubas oder Russlands, um gleichzeitig den Mangel an europäischer Solidarität zu beklagen (Tagesspiegel 26.03.2020).
Doch im Hintergrund wurde ein Mechanismus in Gang gesetzt, der eine Reihe von Notfallmaßnahmen auf europäischer Ebene ermöglichte. Am 2. März 2020 stufte der Ratsvorsitz die integrierte Regelung für die politische Reaktion auf Krisen auf den Vollmodus hoch. Dadurch wurden Round Tables zur Ausarbeitung konkreter Maßnahmen ermöglicht, mit Teilnahme relevanter Akteure wie der Kommission, der Mitgliedstaaten, der EU-Agenturen und unter Beiziehung von ExpertInnen. Die Kommission übernahm die Koordination der gemeinsamen COVID-19-Krisenreaktion und setzte in wesentlichen Politikbereichen wichtige Maßnahmen, wie die folgende Aufstellung zeigt (vgl. Website Europäische Kommission b).
Doch im Hintergrund wurde ein Mechanismus in Gang gesetzt, der eine Reihe von Notfallmaßnahmen auf europäischer Ebene ermöglichte.
1 Gesundheitsmaßnahmen
Die dringendsten Aktivitäten wurden im Bereich der Gesundheitspolitik gesetzt. Die Kommission rief im März ein Beratergremium aus sieben unabhängigen ExpertInnen ein mit dem Ziel, Leitlinien für wissenschaftlich fundiertes Risikomanagement zu entwickeln. Dies beinhaltet die Beratung aller Mitgliedstaaten bei ihren Reaktionen, bei Lücken im klinischen Management, bei der Priorisierung von Gesundheitsversorgung und Katastrophenschutz sowie in Hinblick auf die Eindämmung langfristiger Folgen der Pandemie. Am 19. März wurden Empfehlungen zu Gemeinschaftsmaßnahmen wie Social Distancing und Teststrategien veröffentlicht.
Außerdem versuchte die Kommission die Fehler der Mitgliedstaaten bei der Versorgung mit Schutzausrüstung wettzumachen und diese in ganz Europa sicherzustellen. Nur durch ihre Koordination konnte die Versorgung zwischen den Staaten wiederhergestellt werden. Die Kommission verfügt über den Überblick über die Produktionskapazitäten und Lieferketten und hat eine Empfehlung zur Marktüberwachung gegeben. Es ging dabei unter anderem um die Herstellung von Gesichtsmasken. Die Kommission setzte sich dafür ein, dass Textilhersteller Schutzmasken herstellen können. Wichtig dabei und auch für andere Geräte und deren schnellen Marktzugang war eine dringende Aufforderung der Kommission an die europäischen Normierungsgremien und ihre nationalen Mitglieder hier ein rasches Vorgehen zu ermöglichen. Zusätzlich wurde für Ausfuhren persönlicher Schutzausrüstung in Länder außerhalb der EU eine Ausfuhrgenehmigung der Mitgliedstaaten erforderlich, um sicherzustellen, dass die Verfügbarkeit dieser Ausrüstung innerhalb der Union nicht gefährdet ist. Dies wurde notwendig, weil manche Länder Sorge hatten, bei Ausfuhren von Schutzausrüstung selbst in einen Engpass zu geraten. Seit Ende Februar hat die Kommission außerdem vier Beschaffungsverfahren für diese Schutzausrüstung eingeleitet, um Schutzmasken, Handschuhe, Beatmungsgeräte und Testkits sowie weiteres medizinisch relevantes Material zu beschaffen. Produzenten dieser Geräte reagierten rasch und reichten Angebote ein, die die beantragten Mengen abdecken und sogar überschreiten. Dadurch wurde es der Kommission ermöglicht, einen Vorrat an medizinischer Ausrüstung anzulegen, um sie an besonders betroffene Länder und Regionen zu verteilen. Das war auch die Grundlage dafür, dass viele Hunderte COVID-19-PatientInnen aus Italien oder Frankreich in andere EU-Staaten gebracht und dort behandelt werden konnten.
Insgesamt darf an dieser Stelle nicht übersehen werden, dass die allgemeinen und nicht auf den Krisenfall ausgerichteten EU-Regelungen seit langem allen EU-BürgerInnen Patientenrechte gewähren, die sicherstellen, dass sie bei einem Aufenthalt in einem anderen EU-Staat medizinisch versorgt werden (vgl. Korzilius 2019).
2 Grenz- und Mobilitätsmaßnahmen
Die EU hat neben den Gesundheitsmaßnahmen vor allem im Bereich Grenzen und Mobilität einen weiteren großen Aufgabenbereich in dieser Krise. So wurde einer vorübergehenden Beschränkung nicht wesentlicher Reisen in die EU auf 30 Tage zugestimmt. Die Kommission gab am 23. März Leitlinien für so genannte prioritäre Fahrspuren (Green Lanes) heraus, um einen zügigen Warenfluss zu sichern. Besonders wichtig sind Rückholaktionen von EU-BürgerInnen. So wurden bereits im Jänner mit französischen Maschinen Menschen aus Wuhan ausgeflogen, später auch aus anderen Teilen Chinas, aus Japan, den USA, Marokko, Tunesien oder Georgien usw., wobei die Union logistisch und finanziell Unterstützung gewährte (Website Europäische Kommission c).
3 Wirtschaftsmaßnahmen
Die dritte Ebene, auf der die EU und insbesondere die Kommission aktiv wurde, ist die wirtschaftliche. Die Kommission sagte 1 Milliarde Euro aus dem EU-Haushalt als Garantie für den Europäischen Investitionsfonds zu, um kleine und mittlere Unternehmen liquide zu halten. Weitere 8 Milliarden wurden zur Unterstützung weiterer 100.000 Unternehmen zugesagt. Über die Europäische Investitionsbank sollten weitere hohe Milliardenbeträge an die Wirtschaft fließen (vgl. Website Europäische Kommission b).
Angenommen wurde außerdem ein Vorschlag der Kommission für eine Investitionsinitiative über 37 Milliarden Euro. Dieses Geld sollte aus dem Kohäsionsfonds von nicht in Anspruch genommenen Mitteln stammen. Weitere 28 Milliarden Euro, die den Mitgliedstaaten im Strukturfonds zur Verfügung stehen, sollten auf Vorschlag der Kommission in den Mitgliedstaaten für dringende Ausgaben freigemacht werden können. Eine der wichtigsten wirtschaftlichen Maßnahmen stellt aber die flexible Handhabung der europäischen Haushaltspolitik dar. Die Kommission hat dazu die so genannte Ausweichklausel aktiviert. Damit macht sie außerordentliche fiskalpolitische Unterstützung möglich. Die Regierungen können dadurch Mehrausgaben für die Bewältigung der Krise ohne Konsequenzen für die Haushaltsregeln geltend machen.
Ein weiteres Instrument wurde zur Minderung von Arbeitslosigkeitsrisiken aktiviert (SURE – Support mitigating Unemployment Risks in Emergency). Es soll dazu beitragen, durch die Pandemie bedrohte Arbeitsplätze zu schützen. Dafür werden bis zu 100 Mrd. EUR zur Verfügung gestellt und den Mitgliedstaaten in Form von EU-Darlehen zu günstigen Bedingungen gewährt.
Dass wirtschaftspolitisch noch viel weitergehende Maßnahmen nötig sind und mit großer Wahrscheinlichkeit auch gesetzt werden, wird sich nach Bewältigung der gesundheitlichen Notfallsituation zeigen. Erste Vorschläge zu einem Marshall-Plan für Europa wurden bereits vom spanischen Premierminister Pedro Sánchez und von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen geäußert (Tiroler Tageszeitung 05.04.2020). Auch die Verhandlungen der Euro-Gruppe über adäquate Maßnahmen kamen Anfang April in Schwung. Dabei stand wieder einmal die Frage nach Euro- oder Corona-Bonds im Raum. Die EU-Kommission macht sich in der Debatte für ein Konjunkturpaket im nächsten EU-Haushalt stark (Website Europäische Kommission d).
Dass wirtschaftspolitisch noch viel weitergehende Maßnahmen nötig sind und mit großer Wahrscheinlichkeit auch gesetzt werden, wird sich nach Bewältigung der gesundheitlichen Notfallsituation zeigen.
4 Förderung der Forschung
Die Förderung der Forschung ist ein ganz wesentlicher Teil des gemeinsamen Europas auch in Normalzeiten. In der Krise wurde das noch einmal unterstützt und verstärkt. Die Kommission stellte 140 Millionen Euro für die Entwicklung von Impfstoffen, Behandlungsmethoden, Diagnosetests etc. zur Verfügung, um das Coronavirus zu bekämpfen. In verschiedenen hochkarätig besetzten Projekten wird zu diesen und anderen Fragen geforscht.
5 Bekämpfung von Desinformation
Schließlich setzte sich die Kommission auch für eine objektive, medizinisch und wissenschaftlich gesicherte Kommunikation zum Coronavirus in den sozialen Medien ein und bekämpfte die dort grassierende Fehlinformation. Die zuständige Kommissarin Věra Jourová sprach mit großen Internet-Akteuren über Wege zur Entlarvung gefährlicher Fake News (Handelsblatt 18.03.2020).
Schlussfolgerungen und Handlungsempfehlungen
Die Beschreibung der akuten Krise, die durch die Pandemie über die Welt und Europa gezogen ist, zeigt einige Probleme der Union auf, die nicht ganz neu sind. Erstens befindet sich die EU seit Jahren in einer latenten Krise, aus der sie sich nur mit Reformideen herausmanövrieren kann. Kommt eine akute Krise wie jetzt zur latenten hinzu, so wird es besonders schwierig. Zweitens steht die EU-Kommission (wie auch das Europäische Parlament) in einem kommunikativen Wettbewerb um das Image der Union, und zwar einerseits gegenüber manchen Mitgliedstaaten, andererseits gegenüber anti-europäischen AkteurInnen innerhalb und außerhalb Europas. Drittens zeigt sich im Politikfeld Gesundheit und Soziales, dass die EU mehr Engagement in Richtung einer Harmonisierung oder zumindest einer besseren Koordinierung benötigt, um die Prävention für solche Krisen zu stärken. Daraus leiten sich folgende Handlungsempfehlungen ab:
- Die EU braucht eine dialogorientierte und breite Krisenkommunikation.
In der Krisenkommunikation der Kommission und des Parlaments gibt es Wege, besser zu werden.
Wenn hier die Rede von einer besseren Krisenkommunikation ist, dann ist damit nicht mehr PR oder monologhafte Werbung gemeint, sondern eine transparente, offensive, dialogorientierte Information mit Verweis auf die eigenen Kompetenzen, Aktivitäten, Strukturen und Prozesse. Es ist ein altbekanntes Problem der EU, dass sie ihre Vorteile und Errungenschaften nicht breit und wirkungsvoll vermitteln kann. Dies hat mehrere Gründe. So fehlt es an Wissen darüber, wie die EU funktioniert, wie man mit ihr in Verbindung treten kann und wie sie Entscheidungen trifft. Es fehlt also ganz allgemein an Europabildung. Wer mehr über die Union, ihre Entstehung und ihre Strukturen weiß, kann auch ihre Bedeutung besser einschätzen und ist eher geneigt, sie als positiv zu erachten (Pausch 2011). Europabildung in den Schulen, in der Erwachsenenbildung usw. wäre daher nach wie vor wünschenswert, lässt sich aber nur von den Mitgliedstaaten realisieren.
Ein weiterer Grund ist der Fokus nationaler Medien auf den jeweils eigenen Nationalstaat und die Mängel einer europäischen Öffentlichkeit. Hier stehen in erster Linie nationale Akteure, PolitikerInnen, Parteien, auch Medien etc. in der Pflicht. Sie müssten auf das blame game verzichten und die europäischen Interessen vor die nationale PR stellen. Auch das lässt sich für die EU nur bedingt verändern. In der Krisenkommunikation der Kommission und des Parlaments jedoch gibt es Wege, besser zu werden. So fällt auf, dass die verschiedenen EU-Agenturen oder –Stellen, wie etwa konkret das Zentrum für die Koordination von Notfallmaßnahmen, nicht öffentlich bekannt sind. Eine Website gibt es nur in englischer und französischer Sprache, und selbst diese ist nur durch lange Recherchen zu finden. Auftritte in Social Media fehlen ebenfalls. Europäische BürgerInnen, die diese Einrichtungen und ihre Tätigkeiten nicht kennen, wissen nichts von dem, was in Krisenzeiten in der EU passiert. Es wäre Aufgabe der nationalen EU-Stellen, BürgerInnenservices, Kommissions-Außenstellen und natürlich auch der EU-Abgeordneten, die Leistungen an die BürgerInnen noch besser zu vermitteln, und zwar nicht monologartig, sondern mit der Bereitschaft und dem Aufruf zum demokratischen, kritischen Dialog. Beginnen könnte man mit Websites und Social Media-Auftritten nicht nur von der Kommission und ihren Generaldirektionen, sondern von zentralen, sicherheits- und krisenrelevanten Einrichtungen. Hilfreich könnte auch eine stärkere öffentliche Sichtbarmachung des oder der Krisen-KommissarIn sein, bei dem oder der die Fäden zusammenlaufen. Alles in allem braucht es öffentlich erkennbare Gesichter und Institutionen im Krisenmanagement sowie Transparenz und Information.
- Die EU braucht mehr Kompetenzen im Sozial- und Gesundheitsbereich.
Ein selbstkritischer Blick der EU, insbesondere der Kommission, auf ihre bisherige Effizienzorientierung, auch im Gesundheitsbereich, wäre dringend anzuraten.
Wie die Corona-Krise einmal mehr zeigt, sind Sozial- und Gesundheitswesen der Mitgliedstaaten sehr unterschiedlich. Das beginnt bei der Anzahl der ÄrztInnen und führt bis hin zur so wichtigen Verfügbarkeit von Intensivbetten. Die Diskrepanz zwischen den Staaten wurde schon häufig aufgezeigt (Eurostat 2017). Dass im Fall einer Pandemie so unterschiedliche Ausgangslagen vorherrschen, bringt die Krisenbewältigung in Probleme. Die Prävention solcher Entwicklungen fordert eine stärkere Anpassung. Das sollte auch die Prioritäten relativieren. Intakte Sozial- und Gesundheitssysteme in ganz Europa sollten angestrebt werden. Dazu wäre eine Verlagerung entsprechender Kompetenzen auf EU-Ebene nötig. Ein selbstkritischer Blick der EU, insbesondere der Kommission, auf ihre bisherige Effizienzorientierung, auch im Gesundheitsbereich, wäre dringend anzuraten. Der europäische Einigungsprozess ist in den letzten Jahren in vielen Bereichen von einer Ökonomisierung geprägt, welche die EU-Kommission zumindest mitverantworten muss. Dieser Weg sollte nun überdacht werden. Die Corona-Krise zeigt, dass die Gesundheit und das Leben von EuropäerInnen davon abhängen, wie gut die europäischen Gesundheitssysteme ausgestattet sind und auch davon, in welchem Staat mit welcher Gesundheitspolitik die Menschen leben. Und sie zeigt auch, wie die sozialen Folgen einer solchen Situation je nach Staat unterschiedlich ausfallen. Die Resilienz Europas, sowohl gesundheitlich als auch sozial, würde von einer Kompetenzverlagerung profitieren.
- Die EU braucht eine Reformdebatte in großem Stil.
Das zeigt sich auch daran, dass etwa mit Ungarn ein Land die Krise genutzt hat, um weitere Standards europäischer Demokratien außer Kraft zu setzen.
Man könnte es als Standard-Empfehlung wohl für jeden Policy Brief nennen, aber im Zuge der Corona-Krise wird es noch einmal besonders deutlich: Die EU braucht endlich eine öffentliche Reformdebatte in großem Stil. Das zeigt sich auch daran, dass etwa mit Ungarn ein Land die Krise genutzt hat, um weitere Standards europäischer Demokratien außer Kraft zu setzen. Es ist aber besonders relevant, weil ohne eine solche transparente und breitenwirksame Debatte die anti-europäischen Kräfte innerhalb und außerhalb Europas leichtes Spiel haben, den Zusammenhalt zu zersetzen. Auch wenn diverse Umfragen darauf hindeuten, dass seit dem BREXIT die Zustimmung zur Union in den verbliebenen 27 Ländern wieder gestiegen ist, so vermindert das nicht die Notwendigkeit einer Reform, zumal in akuten Krisen die Gefahr besteht, dass sich die Stimmung wieder verschlechtert. Dass die Union aus jeder Krise gestärkt hervorgeht, mag in vielen Beispielen der Vergangenheit richtig gewesen sein, aber es ist kein Automatismus. Die Reformdebatte, etwa in einem Konvent aus Politik und Zivilgesellschaft, sollte nicht länger aufgeschoben werden. Die Demokratisierung der Union muss vorangetrieben werden, um den autoritären Tendenzen etwas entgegenzusetzen.
Stand des Policy Briefs Anfang April 2020.
- Bild online vom 29.03.2020, abgerufen am 08.04.2020 unter: https://www.bild.de/news/inland/news-inland/coronavirus-sigmar-gabriel-rechnet-mit-europaeischer-union-eu-ab-69697130.bild.html
- Bulmer, Simon/Wessels, Wolfgang 1987. The European Council. Decision Making in European Politics, London: Palgrave MacMillan.
- Die Presse online vom 02.04.2020, abgerufen am 03.04.2020, unter: https://www.diepresse.com/5795063/corona-lehnten-regierungen-eu-hilfe-ab
- Die Welt online vom 16.03.2020, abgerufen am 05.04.2020 unter: https://www.welt.de/debatte/kommentare/plus206533793/Corona-Krise-Die-EU-laesst-Italien-im-Stich-Wir-merken-uns-das.html
- Die Zeit online vom 16.03.2020, abgerufen am 03.04.2020 unter: https://www.zeit.de/politik/deutschland/2020-03/grenzschliessungen-coronavirus-pandemie-deutschland-eu
- Eurostat 2017: Statistiken zur Gesundheitsversorgung, abgerufen am 05.04.2020 unter: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Archive:Healthcare_provision_statistics/de&oldid=357319
- Handelsblatt online vom 18.03.2020, abgerufen am 07.04.2020 unter: https://www.handelsblatt.com/politik/international/coronavirus-eu-kommissionsvizin-jourova-warnt-vor-fake-news-ueber-messenger-dienste-/25658146.html?ticket=ST-860264-KOe5tIJayeds5GcC9WyS-ap1
- Hrbek, Rudold 2003. Föderalismus sui generis–der Beitrag des Konvents zur Verfassungsstruktur der erweiterten EU, in: Zeitschrift für Staats- und Europawissenschaften 1, 3 (2003), S. 430–446.
- Korzilius, Heike 2019. Europäische Gesundheitspolitik. Wie viel Europa darf es sein?, abgerufen am 07.04.2020 unter: https://www.aerzteblatt.de/archiv/207266/Europaeische-Gesundheitspolitik-Wie-viel-Europa-darf-es-sein
- Kurier online vom 16.03.2020, abgerufen am 30.03.2020 unter: https://kurier.at/politik/ausland/grenzkontrollen-macron-kritisiert-einseitige-und-nicht-abgestimmte-entscheidungen/400782713
- Merkel, Wolfgang 2016. Krise der Demokratie? Anmerkungen zu einem schwierigen Begriff, in: Aus Politik und Zeitgeschichte, Bundeszentrale für politische Bildung, Bonn, Vol. 66, Iss. 40/42, S. 4-11.
- Norman, Peter 2004. The Accidential Constitution. The Story of the European Convention, Brussels: EuroComment.
- Pausch, Markus 2011. Politische Bildung und Europa, in: Popp, Reinhold/Pausch, Markus/Reinhardt, Ulrich (Hrsg.). Zukunft.Bildung.Lebensqualität, Wien: LIT-Verlag, S. 167-190.
- Pausch, Markus 2020. Perspectives for Europe. Historical Concepts and Future Challenges, Baden-Baden: Nomos Verlag.
- Website Europäische Kommission a: Emergency Response Coordination Centre, abgerufen am 03.04.2020 unter: https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/emergency-response-coordination-centre-ercc_en
- Website Europäische Kommission b: Coronavirus – Krisenreaktion, abgerufen am 03.04.2020 unter: https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_de
- Website Europäische Kommission c: EU unterstützt die Rückholung von Reisenden nach Europa, abgerufen am 11.04.2020 unter: https://ec.europa.eu/austria/news/europ%C3%A4ische-kommission-will-eu-mittel-f%C3%BCr-r%C3%BCckholungen-und-medizinische-ausr%C3%BCstung-aufstocken_de
- Website Europäische Kommission d: Von der Leyen will Corona-Konjunkturpaket im nächsten langfristigen EU-Haushalt, abgerufen am 4.4.2020 unter: https://ec.europa.eu/germany/news/20200330-corona-konjunkturpaket-eu-haushalt_de
- Website Europäischer Rat: Coronavirus – Krisenreaktion, abgerufen am 04.04.2020 unter: https://www.consilium.europa.eu/de/policies/ipcr-response-to-crises/
- Weidenfeld, Werner 2017. Europas Seele suchen. Eine Bilanz der europäischen Integration. Baden-Baden: Nomos Verlag.
- Website WHO: Corona Virus Disease (COVID-19) Pandemic, abgerufen am 08.04.2020 unter: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
- Tagesspiegel online vom 26.03.2020, abgerufen am 03.04.2020 unter: https://www.tagesspiegel.de/politik/umstrittene-unterstuetzung-in-der-corona-krise-europa-sollte-china-russland-und-kuba-dankbar-sein-fuer-ihre-hilfe/25685164.html
- Tiroler Tageszeitung online, vom 05.04.2020, abgerufen am 07.04.2020 unter: https://www.tt.com/artikel/16833250/von-der-leyen-und-sanchez-wollen-marshall-plan-fuer-europa
ISSN 2305-2635
Die Ansichten, die in dieser Publikation zum Ausdruck kommen, stimmen nicht unbedingt mit jenen der ÖGfE oder jenen der Organisation, für die der Autor arbeiten, überein.
Schlüsselwörter
Corona-Krise, COVID-19, Europäsiche Union, Reformdebatte, Krisenmanagement, Demokratisierung
Zitation
Pausch, M. (2020). Europa in und nach der Corona-Krise. Wien. ÖGfE Policy Brief, 10’2020